Gesetzlicher Biotopschutz nach § 30 BNatSchG
Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Zusammengenommen kommen 5.000 Tier- und Pflanzenarten im Streuobst vor. Seit März 2022 sind Streuobstwiesen gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 BNatSchG bundesweit gesetzlich geschützte Biotope. Dadurch ändert sich die Rechtslage etwa in Baden-Württemberg, wo die „Stückle“ bislang erst ab einer Fläche von 1.500 m² geschützt waren (§ 33a Nat-SchG BW). In Bayern griff der gesetzliche Biotopschutz sogar erst ab einer Fläche von 2.500 m² (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BayNatSchG). In Rheinland-Pfalz genossen diese Hotspots der Artenvielfalt bislang gar keinen Pauschalschutz. Vorbildlich hingegen Brandenburg (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 BbgNatSchG) und Sachsen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 SächsNatSchG), die als Flächenländer den Biotopschutz für Streuobstwiesen landesgesetzlich bereits normiert hatten.
- Veröffentlicht am

1. Gesetzlicher Biotopschutz
Bei einer Vielzahl und Kleinräumigkeit bestimmter wertvoller Biotope ist eine Schutzgebietsausweisung nicht das geeignete Instrument zu ihrer Sicherung. Der Unterschied zwischen dem Gebietsschutz und dem Biotopschutz liegt darin, dass die in § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG und ergänzend in den Landesnaturschutzgesetzen aufgeführten Biotoptypen ohne vorherigen Akt der Unterschutzstellung, sondern unmittelbar durch das Naturschutzgesetz vor einer potenziellen Beeinträchtigung geschützt sind. Die Biotope müssen auch nicht in der Landschaft gekennzeichnet oder in einer Datenbank erfasst sein, damit der gesetzliche Biotopschutz greift.
2. Merkmale einer Streuobstwiese
Um sich der neuen Rechtslage anzunähern, lohnt ein Blick nach Hessen, wo immerhin im Außenbereich gelegene Streuobstwiesen bereits dem gesetzlichen Biotopschutz unterfielen (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 HAGBNatSchG) und sich deswegen der Verwaltungsgerichtshof in Kassel bereits mit der juristischen Definition einer Streuobstwiese befasst hat (Urteil vom 14.08.2018, Az.: 4 A 589/17). Anlass war, dass eine Landwirtin die Feststellung begehrte, dass sie berechtigt sei, eine seit zirka 65 Jahren bestehende Erwerbsobstanlage mit 25 Obststämmen (Süßkirschen) auf einem über 2.000 m² großen Grundstück in Wiesbaden-Frauenstein zu roden. Das Umweltamt der Stadt Wiesbaden hatte die Genehmigung versagt. Demgegenüber meinte die Klägerin, es liege kein gesetzlich geschütztes Biotop „Streuobstbestand“ vor, da nur 10 der insgesamt 25 Obstbäume eine Stammhöhe von mindestens 1,60 m erreichten. Es liege zudem keine überwiegende Bewirtschaftung mit regionaltypischen Süßkirschensorten vor, denn die verwendeten Sorten „Schneiders Rote Knorpelkirsche“ und „Hedelfinger Riesen“ würden weltweit angebaut. Mehrmals pro Jahr werde der Boden mit mineralischem Kunstdünger versehen und zirka zehnmal im Jahr die Blätter mit Pflanzenschutzmitteln gespritzt.
Damit lag ein Grenzfall vor, weswegen der Hessische Verwaltungsgerichtshof eine grundlegendere Definition einer Streuobstwiese beziehungsweise Merkmale zur Abgrenzung vom Plantagenobstanbau vornehmen musste. Das Gericht hat in seinem Urteil die folgenden fünf Kriterien zu dessen Definition herausgehoben:
Es ist erforderlich, dass derObstbaumbestand zu über 50 % aus hochstämmigen Obstbäumen besteht (mindestens 1,60 m Stammhöhe); denn je höher der Stamm, desto größer die Artenvielfalt. Ein hoher Stamm dient zum Beispiel als Habitat von Spechten und Höhlenbewohnern und je höher der Stamm ist, desto größere Bedeutung hat der Baum beispielsweise für bodenbewohnende Tiere, Flechten, Moose und Pilze.
Die Obstbäume müssenüberwiegend extensiv genutzt werden, damit die Bäume ein hohes Alter erreichen können. Denn Obstbäume werden von Jahr zu Jahr etwa durch das zunehmende Potenzial an Höhlen und Totholz ökologisch wertvoller. Die Ertragsdauer der Obstbäume muss daher auf eine lange Lebensdauer – in der Regel auf mindestens 30 Jahre – angelegt sein. In den intensiv genutzten Spindelobst- oder Niedrigstammanlagen einer Obstplantage liegt die ausreichende wirtschaftliche Ertragsdauer der Obstgehölze dagegen typischerweise nur bei maximal 15 bis 20 Jahren, so dass sie als Intensivobstanlagen regelmäßig eine Standzeit von 20 Jahren nicht erreichen. Soweit allerdings früher zur Annahme einer extensiven Nutzung eine geringere oder sogar fehlende Behandlung des Obstbaumbestandes mit Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln für erforderlich angesehen wurde, hält der erkennende Senat dies für die Annahme eines geschützten Biotops „Streuobstbestand“ zwischenzeitlich für überholt und nicht mehr relevant.
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist für die Annahme eines Streuobstbestandes zudem in der Regel erforderlich, dass die Obstbäume überwiegend regionaltypische und damit oft lokale Sorten aufweisen (bspw. HMUKLV-Leitfaden 2016, S. 23).Regionaltypische Sorte bedeutet dabei nicht zwingend, dass die Sorte aus der Region stammt, sondern dass sie in der Region typischerweise vorkommt. Dies gewährleistet, dass wertvolles genetisches Potenzial mit vielseitigen Erbanlagen lokaler Sorten gesichert wird, die zudem zum Teil gegenüber Krankheiten und Schaderregern besonders robust sind sowie eine besondere Frostresistenz und Wuchsstärke aufweisen.
Zwischen den Obstbäumen müssen dieAbstände in der Regel mindestens 8 m groß sein. Alternativ darf die Obstbaumdichte nur maximal 150 Bäume je Hektar betragen, so dass der Einzelbaum als solcher jeweils erkennbar bleibt. Denn um die oben dargestellte Artenvielfalt zu gewährleisten, müssen die Bäume im Biotop Streuobstbestand für die aus naturschutzfachlicher Sicht unter anderem wichtige gute Belichtung des Unterwuchses in weiträumigen Abständen zueinanderstehen. Dabei ist der Platzbedarf im Streuobstbestand allerdings auch abhängig von der Obstart und der Obstsorte aufgrund der unterschiedlichen Wüchsigkeit. So benötigten etwa Quitten, Pflaumen/Zwetschgen und Sauerkirschen weniger Pflanzabstände als Süßkirschen, Äpfel, Birnen und Nüsse.
DieMindestfläche für die Annahme eines Streuobstbestandes muss schließlich1.000 m² betragen, wobei nicht zwingend einzelne Flurstücke geschützt sind, sondern der zusammenhängende Baumbestand auch über Grundstücksgrenzen hinweg. Die Flächengröße ist bei Streuobstbeständen im Hinblick auf die Tierwelt von Bedeutung, denn sie stellt einen limitierenden Faktor für die betroffenen Populationen dar und bestimmt die Artenzahl. Ob es bei Nichterreichen der Mindestgröße für die Annahme eines Streuobstbestandes auch ausreichend ist, wenn mindestens zehn Bäume vorhanden sind (HMUKLV-Leitfaden 2016, S. 22), hat der Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich offengelassen. Die Gesetzesbegründung zur BNatSchG-Novelle lässt „mindestens 10 Bäumen, überwiegend aus Hochstämmen (mindestens 160 cm Stammhöhe)“ als Mindestgröße ausreichen.
3. Rechtsfolgen
§ 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG verbietet alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen können. Es kommt nach dem Wortlaut („können“) allein auf die Möglichkeit der Schädigung durch die beabsichtigte Maßnahme an. Eine Handlungspflicht, bestimmte Pflegemaßnahmen zu ergreifen beziehungsweise fortzuführen, statuiert § 30 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG hingegen nicht, so dass ein schlichtes Unterlassen wie die Aufgabe der Bewirtschaftung und Pflege einer Streuobstwiese nicht unter das Verbot fällt. Von dem Verbot der möglichen Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung des Biotops kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Gemäß § 30 Abs. 4 BNatSchG kann die Ausnahme bereits auf der Ebene des Bebauungsplans auf Antrag der Gemeinde von der Naturschutzbehörde erteilt werden.
Zeitgeschehen
Das Recht ist nicht statisch. Auch die den Naturschutz betreffenden Verordnungen und Gesetze werden bei Bedarf angepasst. Hier informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen. Alle Änderungen können Sie über nul-online.de, Webcode NuL5715, direkt ansteuern.
Im Rahmen des sogenannten „Sommerpakets“ der Bundesregierung wird im Umweltministerium derzeit an einer Novelle des BNatSchG gearbeitet, die den Artenschutz betreffen wird. Mit Hilfe des „Sommerpakets“ sollen alle notwendigen Gesetze und Verordnungen möglichst bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, damit Deutschland bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 80 % steigern und bis 2045 klimaneutral werden kann.
Autoren

Barrierefreiheit Menü
Hier können Sie Ihre Einstellungen anpassen:
Schriftgröße
Kontrast








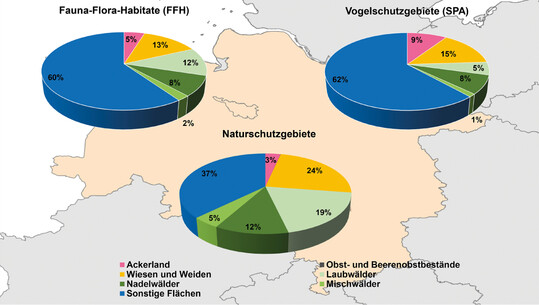

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.